Wintersport wird in Naturräumen ausgeübt, die auch Lebensraum für zahlreiche störungssensible Tierarten sind. Diese gilt es durch verantwortungsvolles Verhalten zu schützen.
Projektbeschreibung
Wintersportaktivitäten haben in den letzten Jahren insbesondere außerhalb des gesicherten Pistenraums stark zugenommen. Doch was für Tourengeher und Freerider Entspannung und Vergnügen ist, kann für Wildtiere schnell im Dauerstress enden. Wildtiere sind so menschlichen Reizen ausgesetzt und finden immer seltener Rückzugsmöglichkeiten. Gemeinsam mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt und der Deutschen Sporthochschule Köln wurde die Broschüre „Wildtiere & Freizeitaktivitäten im Wald“ entwickelt.
Ziel
Die Stiftung Sicherheit im Skisport setzt sich für die Sensibilisierung hinsichtlich einer umwelt- und wildtierfreundlichen Wintersportausübung ein. Außerdem initiiert und fördert sie Maßnahmen der Umweltbildung und Besucherlenkung in Wintersporträumen. Ziel ist es sensible Tierarten im alpinen Raum und in den Mittelgebirgen zu schützen, Besucherströme zu regulieren und Störreize zu vermeiden.
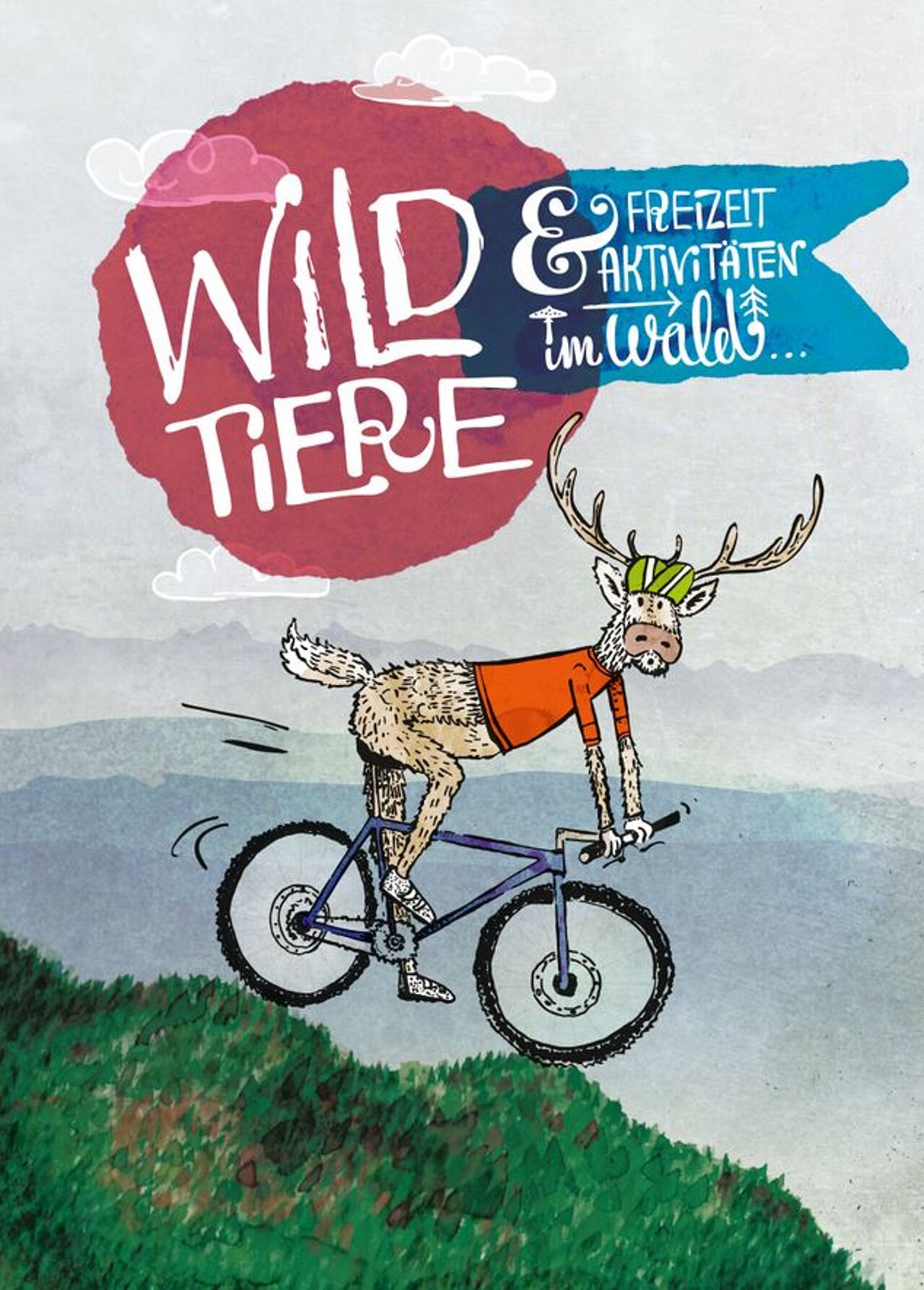
Tipps & Wissenswertes
Die alpine Bergwelt ist Lebensraum zahlreicher Tierarten. Unter ihnen spiegeln die sogenannten Charakterarten den Zustand der Landschaft stellvertretend für viele andere Tiere wider. Zu ihnen gehören das Schalenwild (Rotwild, Rehwild, Gamswild, Steinwild) und die Gruppe der Raufußhühner (Schneehuhn, Birkhuhn, Auerhuhn und Haselhuhn). Die seltenen Vogelarten der Raufußhühner sind durch Umweltveränderungen gefährdet. Darüber hinaus prägt eine Vielzahl anderer Vögel und Kleintiere das Gesamtökosystem der Alpen. Die überwiegend in der Erde lebenden Kleinstlebewesen wirken in millionenfacher Vielfalt bei allen Lebensprozessen mit und sind ein entscheidender Faktor für die Fruchtbarkeit der Böden.
Für das Störungsempfinden von Wildtieren ist es vor allem entscheidend, ob menschliche Aktivitäten »auf Pisten und Wegen« oder »abseits von Wegen« stattfinden. Wildtiere können potenzielle Gefahren auf Pisten und Wegen richtig einschätzen und ihr Verhalten an die Störreize anpassen oder sich an diese gewöhnen. Doch bereits ein einzelner Mensch, der abseits der Wege unterwegs ist, kann diese Gewöhnung verhindern und energiezehrende Fluchtreaktionen auslösen. Jede Fluchtreaktion verbraucht sehr viel Energie, welche durch das mangelnde Nahrungsangebot kaum kompensiert werden kann. Auf Störung folgt oft Flucht, welche vielfältige Folgen haben kann. Der Energieverbrauch steigt enorm an, Nahrungs- und Ruheplätze werden gemieden, die Zeit für die Nahrungsaufnahme wird verkürzt und der Fortpflanzungserfolg wird gemindert. Aber auch im Wald sind die Folgen von Störungen sichtbar. Gestresste Wildtiere verstecken sich in dichten Waldbeständen und beginnen Rinde von den Bäumen zu schälen oder junge Triebe abzubeißen, was zu wirtschaftlichen Schäden im Wald führen kann.
- Ausgewiesene Pisten, Wege und Aufstiegsrouten nutzen
- Dämmerungs- und Nachtzeiten möglichst meiden
- Waldränder, Gehölze, Dickichte und Aufforstungen, in die sich das Wild zurückzieht meiden – daher auf Freiflächen bleiben!
- Die mit Stoppschildern und -Bannern gekennzeichneten Bereiche und gesperrte Wege keinesfalls betreten

